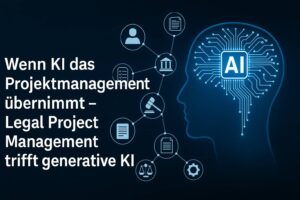Scheinselbstständigkeit bei Projektjuristen: Neue Risiken durch KI-gestützte Prüfungen

Die Zusammenarbeit mit selbstständigen Projektjuristen bietet Kanzleien und Unternehmen wertvolle Flexibilität. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen werden zunehmend komplexer – und die Kontrollmechanismen schärfer. Mit dem Einsatz von KI-gestützten Prüfverfahren durch die Deutsche Rentenversicherung intensiviert sich die Überwachung von Auftragsverhältnissen erheblich.
Die neue Dimension der Prüfung: KIRA im Einsatz
Die Deutsche Rentenversicherung setzt seit einiger Zeit das KI-gestützte System KIRA (Künstliche Intelligenz für Rentenversicherungsabläufe) ein, um potenzielle Scheinselbstständigkeit systematisch aufzudecken. Das System analysiert große Datenmengen und identifiziert Muster, die auf abhängige Beschäftigung hindeuten können.
KIRA ermöglicht eine deutlich effizientere und umfassendere Überprüfung von Beschäftigungsverhältnissen als traditionelle manuelle Verfahren. Die Behörden können damit gezielter Branchen und Tätigkeitsfelder identifizieren, in denen erhöhte Risiken bestehen – und die Rechtsbranche mit ihren Projektjuristen gehört definitiv dazu.
Für Unternehmen und Auftraggeber bedeutet dies ein erhöhtes Haftungsrisiko. Bei festgestellter Scheinselbstständigkeit drohen Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen, die bis zu vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden können – bei Vorsatz sogar bis zu 30 Jahre. Hinzu kommen potenzielle Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen.
Was die Rechtsprechung lehrt: Kernkriterien der Abgrenzung
Die jüngere Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zeigt deutlich: Die formale Vertragsgestaltung allein reicht nicht aus. Entscheidend ist die tatsächliche Durchführung der Zusammenarbeit.
Das Urteil vom 31.03.2017 (B 12 R 7/15 R) stellt klar: Die tatsächliche Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses ist maßgeblich, nicht die gewählte Bezeichnung oder formale Vertragsstruktur. Die Gerichte prüfen, wie die Zusammenarbeit real gelebt wird.
In den beiden „Honorarärzte“-Entscheidungen von 2019 hat das BSG wichtige Grundsätze aufgestellt: Selbst wenn Fachkräfte weitgehend weisungsfrei arbeiten, kann eine organisatorische Eingliederung in die Betriebsstruktur des Auftraggebers zur Annahme einer abhängigen Beschäftigung führen (BSG, 04.06.2019 – B 12 R 11/18 R). Fachliche Weisungsfreiheit – ein Kernmerkmal juristischer Arbeit – schließt eine abhängige Beschäftigung nicht automatisch aus (BSG, 07.06.2019 – B 12 R 10/19 R). Auch Akademiker und freie Berufe können beschäftigt sein.
Besonders bedeutsam ist das Urteil vom 19.10.2021 (B 12 R 17/19 R), das das wirtschaftliche Risiko als entscheidendes Abgrenzungskriterium hervorhebt. Wer kein unternehmerisches Risiko trägt, ist tendenziell abhängig beschäftigt. Bereits 2008 hatte das BSG klargestellt: Auch Angehörige klassischer freier Berufe wie Rechtsanwälte können in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis tätig sein (BSG, 28.05.2008 – B 12 KR 13/07 R).
Die wirtschaftliche Risikotragung als Kernkriterium
Die Rechtsprechung betont zunehmend das unternehmerische Risiko als wesentliches Abgrenzungsmerkmal. Ein echter Selbstständiger trägt Akquisitionsrisiko, Haftungsrisiko und Investitionsrisiko. Er kann Verluste erleiden, muss in seine Infrastruktur investieren und trägt das Risiko der Auftragslage.
Für Projektjuristen bedeutet dies konkret: Investitionen in die eigene Kanzleiausstattung und Fortbildung sind ebenso wichtig wie Ausgaben für Marketing und Akquise. Zeiten ohne Aufträge müssen finanziell überbrückt werden. Die Haftung für eigene Fehler wird durch eine Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt, die der Projektjurist selbst bezahlt. Es gibt keine Absicherung durch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Besondere Risikobereiche bei Projektjuristen
Bestimmte Konstellationen sind besonders anfällig für die Annahme von Scheinselbstständigkeit. Langfristige Exklusivität ist ein erhebliches Risiko: Wenn ein Projektjurist über Jahre hinweg ausschließlich oder überwiegend für einen Auftraggeber tätig ist, deutet dies stark auf ein Beschäftigungsverhältnis hin.
Die Integration in die Arbeitsorganisation sendet ebenfalls kritische Signale. Die Teilnahme an regelmäßigen internen Besprechungen, die Nutzung von Firmen-E-Mail-Adressen oder die Aufnahme in Vertretungspläne spricht gegen Selbstständigkeit. Ähnlich problematisch ist eine stundenbasierte Vergütung mit festen Anwesenheitszeiten: Wenn die Vergütung faktisch einem Stundenlohn entspricht und bestimmte Anwesenheitszeiten erwartet werden, liegt die Vermutung einer Beschäftigung nahe.
Auch die fehlende eigene Infrastruktur kann zum Problem werden. Wer ausschließlich mit den Arbeitsmitteln des Auftraggebers arbeitet und keine eigene Geschäftsausstattung hat, gefährdet den Selbstständigenstatus.
Handlungsempfehlungen für Projektjuristen
Als selbstständiger Projektjurist sollten Sie Ihre Tätigkeit bewusst so gestalten, dass die Selbstständigkeit klar erkennbar ist. Die Betreuung mehrerer Auftraggeber parallel ist dabei ein zentraler Baustein. Arbeiten Sie gleichzeitig für verschiedene Mandanten. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Auftraggeber ist ein starkes Indiz für Scheinselbstständigkeit, auch wenn wirtschaftliche Abhängigkeit allein nicht ausschlaggebend ist. Dokumentieren Sie Ihre verschiedenen Mandate und deren zeitliche Verteilung.
Das Tragen eines eigenen unternehmerischen Risikos zeigt sich in vielen Facetten. Investieren Sie in eigene Arbeitsmittel wie Laptop, Software und Fachliteratur. Tragen Sie Akquisitionskosten und Vermarktungsaufwand. Betreiben Sie aktives Marketing durch eine eigene Website und LinkedIn-Präsenz. Zahlen Sie für Ihre eigene Berufshaftpflichtversicherung und organisieren Sie Ihre Fort- und Weiterbildung auf eigene Kosten.
Die eigenständige Arbeitsorganisation ist ein weiteres Schlüsselelement. Bestimmen Sie Arbeitsort und Arbeitszeit selbst. Lehnen Sie die Bereitstellung eines festen Arbeitsplatzes beim Auftraggeber ab oder nutzen Sie ihn nur gelegentlich. Verwenden Sie eigene E-Mail-Adressen und Kommunikationskanäle. Erscheinen Sie nicht in der Organisationsstruktur des Auftraggebers, also in keinen Telefonlisten, Organigrammen oder im Intranet.
Bei der Honorargestaltung sollten Sie reine Stundenhonorar-Abrechnungen vermeiden, die einem Gehalt ähneln. Vereinbaren Sie stattdessen Projektpauschalen für definierte Arbeitspakete, Tagessätze mit klar abgegrenzten Aufträgen, erfolgsabhängige Komponenten wo möglich, und flexible Zahlungsmodalitäten, die nicht monatlich-gleichbleibend sind.
Jeder Auftrag sollte klar abgegrenzt sein. Definieren Sie ihn schriftlich mit konkretem Projektziel und Leistungsumfang, zeitlicher Befristung, eigenverantwortlichem Ergebnisbereich und der Möglichkeit zur Ablehnung weiterer Aufträge. Die fachliche Weisungsfreiheit sollten Sie dokumentieren: Bestimmen Sie die Vorgehensweise und Methodik selbst, entscheiden Sie über den Einsatz von Hilfspersonal, wählen Sie die rechtlichen Lösungswege eigenständig und halten Sie diese Entscheidungsfreiheit fest.
Handlungsempfehlungen für Auftraggeber
Als Kanzlei oder Unternehmen, das mit Projektjuristen zusammenarbeitet, beginnt die rechtssichere Gestaltung bei der Vertragsgestaltung. Formulieren Sie Werkverträge oder freie Dienstverträge, keine arbeitsvertraglichen Regelungen. Vermeiden Sie Begriffe wie „Mitarbeiter“, „Weisungsrecht“ oder „Urlaubsanspruch“. Definieren Sie konkrete Projektziele statt allgemeiner Tätigkeitsbeschreibungen. Vereinbaren Sie kurze bis mittelfristige Projektlaufzeiten von drei bis zwölf Monaten und schließen Sie das Recht auf Ablehnung weiterer Aufträge explizit ein.
Die organisatorische Eingliederung müssen Sie konsequent vermeiden. Stellen Sie keinen festen Arbeitsplatz dauerhaft zur Verfügung. Integrieren Sie Projektjuristen nicht in Ihre IT-Infrastruktur, also keine firmeninternen E-Mail-Adressen. Nehmen Sie sie nicht in Organigramme, Telefonlisten oder das Intranet auf. Laden Sie sie nicht zu regulären Teammeetings oder Betriebsversammlungen ein. Gewähren Sie keinen Zugang zu allgemeinen Mitarbeiterbenefits.
Die Weisungsfreiheit muss praktisch gelebt werden. Geben Sie keine Vorgaben zu Arbeitszeit und Arbeitsort. Kontrollieren Sie nicht die tägliche Anwesenheit. Fokussieren Sie auf Ergebnisse, nicht auf den Arbeitsprozess. Überlassen Sie die Methodenwahl dem Projektjuristen und dokumentieren Sie die eigenverantwortliche Arbeitsweise.
Beim Vergütungsmodell sollten Sie keine monatlich gleichbleibenden Beträge zahlen. Vereinbaren Sie stattdessen Projekt- oder Tagespauschalen. Rechnen Sie nach tatsächlich erbrachten Leistungen ab und vermeiden Sie zusätzliche Zahlungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder Spesen.
Die Dokumentation spielt eine zentrale Rolle. Halten Sie schriftlich fest: die konkrete Projektdefinition und Abgrenzung, die eigenverantwortliche Arbeitsweise, die Nutzung eigener Arbeitsmittel durch den Projektjuristen, die Zusammenarbeit mit anderen Auftraggebern (soweit bekannt) und die Ablehnung von organisatorischer Eingliederung.
Bei Unsicherheiten können Sie oder der Projektjurist ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Dies schafft Rechtssicherheit für beide Seiten, wobei das Verfahren allerdings mehrere Monate dauern kann.
(Langfristige) Zusammenarbeit mit einem Hauptauftraggeber
Eine der häufigsten Praxissituationen ist die langjährige Zusammenarbeit mit einem Hauptauftraggeber, der 70 bis 80 Prozent der Einkünfte generiert. Diese Konstellation ist weder ungewöhnlich noch grundsätzlich problematisch – sie erfordert aber besondere Sorgfalt in der Gestaltung.
Wirtschaftliche Abhängigkeit ist nicht entscheidend
Ein häufiges Missverständnis muss zunächst ausgeräumt werden: Wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Hauptauftraggeber führt nicht automatisch zur Scheinselbstständigkeit. Die Rechtsprechung erkennt ausdrücklich an, dass Selbstständige einen Großteil ihrer Einkünfte von einem Auftraggeber beziehen können. Das BSG hat bereits 2001 festgehalten: „Eine wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Auftraggeber schließt Selbstständigkeit nicht aus“ (BSG, 25.01.2001 – B 12 KR 17/00 R). In einer späteren Entscheidung betonte das Gericht: „Auch langjährige Zusammenarbeit mit einem Hauptauftraggeber kann selbstständig sein, wenn die übrigen Kriterien der Selbstständigkeit erfüllt sind“ (BSG, 11.03.2009 – B 12 R 11/07 R).
Entscheidend ist die Gesamtschau aller Umstände. Dabei wiegen andere Faktoren schwerer als die reine Umsatzkonzentration: die organisatorische Eingliederung oder deren Fehlen, die Weisungsgebundenheit bezüglich Zeit, Ort und Art der Tätigkeit, das unternehmerische Risiko und Investitionen, eigene Betriebsmittel sowie die Möglichkeit, für andere zu arbeiten – auch wenn man es tatsächlich nicht ausschöpft.
Gestaltungsmöglichkeiten bei etablierten Langfristmandaten
Wenn Sie bereits seit Jahren für einen Hauptauftraggeber tätig sind, sollten Sie die Zusammenarbeit gezielt anpassen. Die Strukturierung durch befristete Projektverträge ist dabei zentral. Statt eines unbefristeten Rahmenvertrags schließen Sie aufeinanderfolgende befristete Projektverträge für sechs bis zwölf Monate. Definieren Sie für jedes Projekt konkrete, abgrenzbare Leistungsziele. Dokumentieren Sie zwischen den Projekten bewusste Entscheidungen zur Fortsetzung und verhandeln Sie Konditionen bei Projektverlängerungen neu.
Ein praktisches Beispiel: Sie arbeiten seit drei Jahren als Projektjurist für eine Kanzlei. Statt eines durchlaufenden Vertrags gestalten Sie die Zusammenarbeit um in halbjährliche Projektverträge. Das erste Projekt für Q1/Q2 2025 könnte lauten: „Bearbeitung aller M&A-Transaktionen im Bereich Life Sciences“ mit definiertem Leistungsumfang. Das darauffolgende Projekt für Q3/Q4 2025 hätte einen anderen Fokus: „Due Diligence für Portfoliounternehmen X, Y, Z“ mit neuer Honorarvereinbarung.
Die sichtbare Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit bleibt auch bei 80 Prozent Umsatzanteil eines Auftraggebers wichtig. Pflegen Sie eine professionelle Website mit Leistungsspektrum. Nutzen Sie LinkedIn aktiv zur Positionierung als selbstständiger Experte. Führen Sie ein eigenes Impressum und eigene Geschäftsausstattung. Verwenden Sie eine eigene E-Mail-Adresse und eigenes Briefpapier.
Dokumentierte Akquisebemühungen unterstützen Ihren Status zusätzlich. Nehmen Sie an Fachveranstaltungen teil und bewahren Sie die Teilnahmebescheinigungen auf. Führen Sie Gespräche mit potenziellen weiteren Mandanten und fertigen Sie Gesprächsnotizen an. Schalten Sie gelegentlich Werbeanzeigen oder betreiben Sie Content-Marketing. Pflegen Sie ein berufliches Netzwerk sichtbar. Wichtig ist: Es geht nicht darum, tatsächlich sofort weitere große Mandate zu gewinnen, sondern zu dokumentieren, dass Sie prinzipiell am Markt tätig sind und weitere Aufträge annehmen könnten.
Die operative Selbstständigkeit muss konkret gelebt werden. Arbeiten Sie überwiegend von Ihrem Home-Office oder einem Co-Working-Space. Wenn Sie beim Auftraggeber vor Ort sein müssen, nutzen Sie flexible Arbeitsplätze ohne festen Schreibtisch. Vermeiden Sie die Integration in Raumplanung oder Zugangssysteme des Auftraggebers. Dokumentieren Sie flexible Arbeitszeiten, also auch mal vormittags, abends oder am Wochenende. Nehmen Sie sich Auszeiten ohne „Urlaubsantrag“. Arbeiten Sie parallel an eigenen Projekten wie Fortbildung, Fachartikeln oder Nebenmandaten. Nutzen Sie Ihren eigenen Laptop und eigene Software-Lizenzen. Verwenden Sie eigene Cloud-Lösungen und greifen Sie nur projektbezogen auf Systeme des Auftraggebers zu.
Bei der Honorargestaltung sollten Sie arbeitnehmerähnliche Strukturen vermeiden. Monatlich gleichbleibende Pauschalbeträge plus Stundenabrechnung darüber hinaus, feste „Anwesenheitstage“ mit Tagessätzen oder Abrechnungen nach tatsächlichen Arbeitsstunden wie bei einer Arbeitszeiterfassung sind problematisch. Besser sind Projektpauschalen mit Meilenstein-Zahlungen, Tagessätze für klar definierte Arbeitseinheiten statt bloßer Anwesenheit, erfolgsbasierte Komponenten wo möglich und jährliche Honorarverhandlungen mit Anpassung.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Statt „40 Stunden pro Woche à 150 Euro gleich 6.000 Euro pro Monat“ vereinbaren Sie „Betreuung des Due-Diligence-Projekts X inklusive Report: 15.000 Euro, Zahlung bei Abschluss“ oder „Beratungsretainer Q2/2025: 18.000 Euro für maximal zehn Beratungstage nach Abruf, nicht abgerufene Tage verfallen“.
Die Bedeutung der „Satelliten-Auftraggeber“
Auch wenn kleinere Nebenmandanten nur 20 Prozent Ihres Umsatzes ausmachen, sind sie wertvoll für die Außenwirkung. Schaffen Sie Sichtbarkeit, indem Sie diese Mandate auf Ihrer Website erwähnen, anonymisiert wenn nötig. Erstellen Sie Referenzen oder Case Studies und zeigen Sie die Bandbreite Ihrer Expertise.
Bei diesen Nebenmandaten gilt: Qualität vor Quantität. Zwei bis drei kleinere, aber dokumentierte Mandate sind besser als vage „Gelegenheitsarbeiten“. Auch Pro-Bono-Arbeit oder Fachpublikationen zählen als eigenständige Tätigkeit. Lehraufträge, Vorträge und Gutachtertätigkeit unterstreichen Ihre Selbstständigkeit ebenfalls.
Dokumentieren Sie die zeitliche Parallelität. Führen Sie eine Projektliste, die zeigt, dass Sie gleichzeitig verschiedene Mandate betreuen. Dokumentieren Sie in Statusberichten an den Hauptauftraggeber, wenn Sie zeitweise nicht verfügbar sind wegen anderer Projekte.
Das Kündigungsrecht als Ausdruck der Freiheit
Ein oft übersehener Aspekt: Dokumentieren Sie, dass Sie jederzeit das Recht haben, das Mandat zu beenden oder neue Aufträge abzulehnen. Vereinbaren Sie kurze Kündigungsfristen von vier bis acht Wochen, nicht drei Monate wie bei Arbeitnehmern. Lehnen Sie gelegentlich zusätzliche Ad-hoc-Anfragen ab und dokumentieren Sie dies. Verhandeln Sie bei Verlängerungen aktiv, nicht durch automatische Fortführung. Schreiben Sie ins Protokoll: „Der Projektjurist behält sich vor, parallel weitere Mandate anzunehmen.“
Das 70-20-10-Modell als pragmatische Lösung
In der Praxis hat sich eine Struktur bewährt, die wirtschaftliche Stabilität mit rechtlicher Sicherheit verbindet. 70 Prozent bleiben beim Hauptauftraggeber als langfristiges Kernmandat mit stabiler Einkommensbasis. Dieses wird projektbasiert in Sechs- bis Zwölf-Monats-Einheiten strukturiert, mit klarer operativer Selbstständigkeit und eigener Infrastruktur.
20 Prozent entfallen auf Satelliten-Mandate, also zwei bis drei kleinere, aber sichtbare weitere Auftraggeber. Diese müssen nicht gleich lukrativ sein wie das Hauptmandat. Wichtig ist, dass sie zeitlich parallel zum Hauptmandat laufen und Ihre Marktteilnahme sowie Akquisefähigkeit dokumentieren.
Die verbleibenden 10 Prozent fließen in Eigenprojekte: Fortbildung, Fachpublikationen, Vorträge, Pro-Bono-Arbeit mit juristischem Bezug, die Entwicklung eigener Produkte wie E-Books, Kurse oder Tools sowie Networking und Markenpflege.
Diese Aufteilung signalisiert mehrere wichtige Botschaften: Sie sind am Markt aktiv, nicht nur bei einem Auftraggeber. Sie investieren in Ihre Selbstständigkeit, sowohl Zeit als auch Geld. Sie haben unternehmerisches Risiko und Gestaltungsspielraum. Sie könnten theoretisch auch andere Schwerpunkte setzen.
Umgestaltung einer problematischen Situation: Ein Praxisbeispiel
Nehmen wir eine typische Ausgangssituation: Sie arbeiten seit vier Jahren als Projektjurist für eine mittelständische Kanzlei, 80 Prozent Ihrer Einkünfte kommen von dort. Sie haben einen „Rahmenvertrag“, arbeiten drei bis vier Tage pro Woche vor Ort am bereitgestellten Arbeitsplatz, nehmen an Teambesprechungen teil und rechnen nach Stunden ab.
Die Umgestaltung erfolgt in drei Schritten. Sofortige Anpassungen können Sie ohne Neuverhandlung vornehmen: Arbeiten Sie ab sofort überwiegend von zuhause. Verwenden Sie Ihren eigenen Laptop und eigene E-Mail. Nehmen Sie nicht mehr an wöchentlichen Team-Meetings teil. Aktualisieren Sie Ihre LinkedIn-Präsenz und Website. Dokumentieren Sie zwei kleine Nebenmandaten, die Sie parallel betreuen.
Die Vertragsanpassung stimmen Sie mit dem Auftraggeber ab: Stellen Sie von Rahmenvertrag auf halbjährliche Projektverträge um. Ersetzen Sie die Stundenabrechnung durch Projektpauschalen oder Tagessätze für definierte Arbeitspakete. Vereinbaren Sie schriftlich: flexible Arbeitszeit und -ort, keine Anwesenheitspflicht. Halten Sie explizit fest: Das Recht zur Annahme anderer Mandate ist jederzeit gegeben.
Die mittelfristige Diversifizierung setzen Sie über sechs bis zwölf Monate um: Akquirieren Sie ein zweites mittleres Mandat, das mindestens 10 bis 15 Prozent Ihres Umsatzes ausmacht. Veröffentlichen Sie zwei bis drei Fachartikel oder halten Sie Vorträge in Ihrem Spezialgebiet. Bauen Sie eine erkennbare Expertenpositionierung auf. Dokumentieren Sie Investitionen in Ihre Selbstständigkeit.
Das Ergebnis nach zwölf Monaten: Sie haben eine klar projektbasierte Zusammenarbeit mit dem Hauptauftraggeber etabliert. Ihre operative Selbstständigkeit ist sichtbar. Sie betreuen mehrere Mandanten parallel, auch wenn diese unterschiedlich groß sind. Ihre Marktteilnahme und unternehmerische Aktivität ist dokumentiert. Das Risiko bei einer Prüfung ist deutlich geringer.
Praktische Checkliste zur Selbstprüfung
Beide Seiten sollten regelmäßig prüfen, ob die Zusammenarbeit den Kriterien echter Selbstständigkeit entspricht. Für Projektjuristen ergeben sich folgende Prüfpunkte: Arbeite ich für mindestens zwei bis drei verschiedene Auftraggeber? Nutze ich überwiegend eigene Arbeitsmittel? Trage ich eigenes wirtschaftliches Risiko durch Akquise, Investitionen und Auftragsschwankungen? Bestimme ich Arbeitsort und -zeit selbst? Habe ich eine eigene Berufshaftpflichtversicherung? Betreibe ich aktives Marketing für meine Dienstleistungen? Erfolgt meine Vergütung projekt- oder leistungsbezogen, nicht stundenbasiert? Bin ich nicht in die Organisationsstruktur des Auftraggebers eingebunden?
Für Auftraggeber lauten die Prüfpunkte: Arbeitet der Projektjurist erkennbar auch für andere Mandanten? Gibt es keine festen Arbeitszeiten oder Anwesenheitspflichten? Wird kein dauerhafter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt? Erfolgt keine Integration in interne Kommunikationsstrukturen wie E-Mail oder Intranet? Erfolgt die Vergütung nicht nach Stunden, sondern nach Projekten oder Ergebnissen? Gibt es keine Teilnahme an regulären Mitarbeiter-Meetings oder -Benefits? Liegt eine klare projektbezogene Beauftragung mit definiertem Leistungsumfang vor? Ist die Dokumentation der eigenverantwortlichen Arbeitsweise vorhanden?
Fazit: Selbstständigkeit bei komplexen Konstellationen ist möglich
Die Zusammenarbeit mit einem Hauptauftraggeber über Jahre hinweg oder der Übergang von der Anstellung zur Selbstständigkeit beim selben Auftraggeber sind grundsätzlich möglich und rechtlich zulässig. Beide Konstellationen erfordern aber besondere Sorgfalt in der Gestaltung und Dokumentation.
Die wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Hauptauftraggeber allein führt nicht zur Scheinselbstständigkeit. Entscheidend ist die Gesamtschau aller Umstände, wobei die operative Selbstständigkeit, das unternehmerische Risiko und die eigene Infrastruktur wichtiger sind als die Umsatzverteilung.
Beim Übergang von der Anstellung zur Selbstständigkeit ist besondere Vorsicht geboten. Eine Wartefrist von drei bis sechs Monaten und substanzielle Änderungen der Arbeitsbedingungen sind empfehlenswert. Bei sofortigem Übergang sollte zwingend ein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt werden.
Die drei Erfolgsfaktoren bleiben in beiden Konstellationen gleich: Erstens müssen Sie die operative Selbstständigkeit konsequent leben, nicht nur vertraglich vereinbaren, sondern täglich praktizieren durch eigene Arbeitsmittel, flexible Zeiten und eigenverantwortliche Arbeit. Zweitens sollten Sie die Projektbasierung statt Dauertätigkeit wählen und die Zusammenarbeit in abgegrenzte, befristete Projekte mit klaren Zielen strukturieren. Drittens benötigen Sie eine dokumentierte Marktteilnahme, die durch Website, LinkedIn, Nebenmandaten und Fachaktivitäten zeigt, dass Sie als Selbstständiger am Markt tätig sind.
Die verschärfte Prüfung durch KIRA und andere KI-gestützte Systeme macht diese Gestaltung nicht unmöglich, sie macht sie nur wichtiger. Wer die Kriterien erfüllt und sorgfältig dokumentiert, hat auch bei intensiver Prüfung nichts zu befürchten. Die proaktive Gestaltung ist in jedem Fall der reaktiven Korrektur nach einer behördlichen Prüfung vorzuziehen.